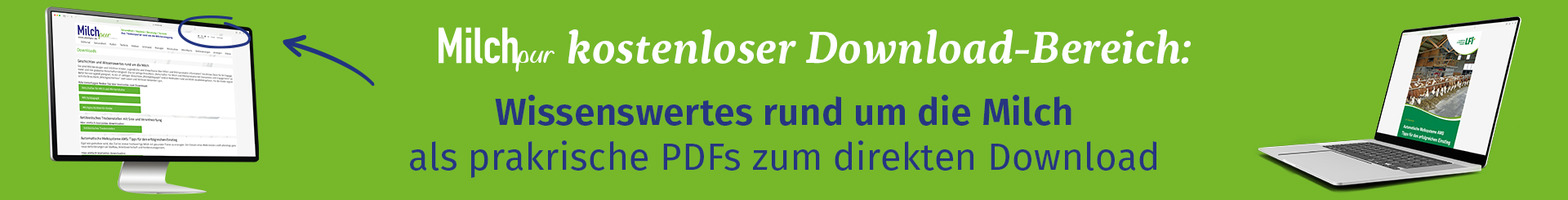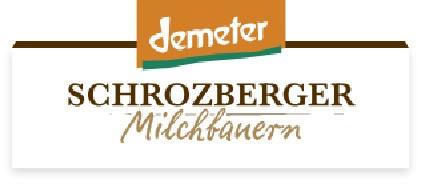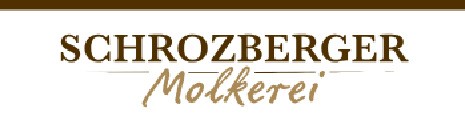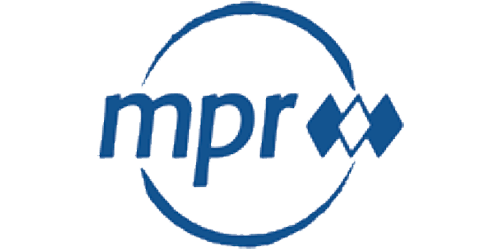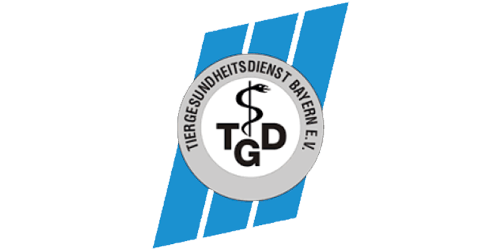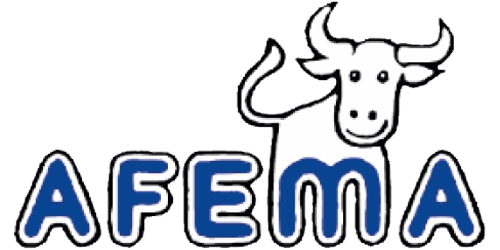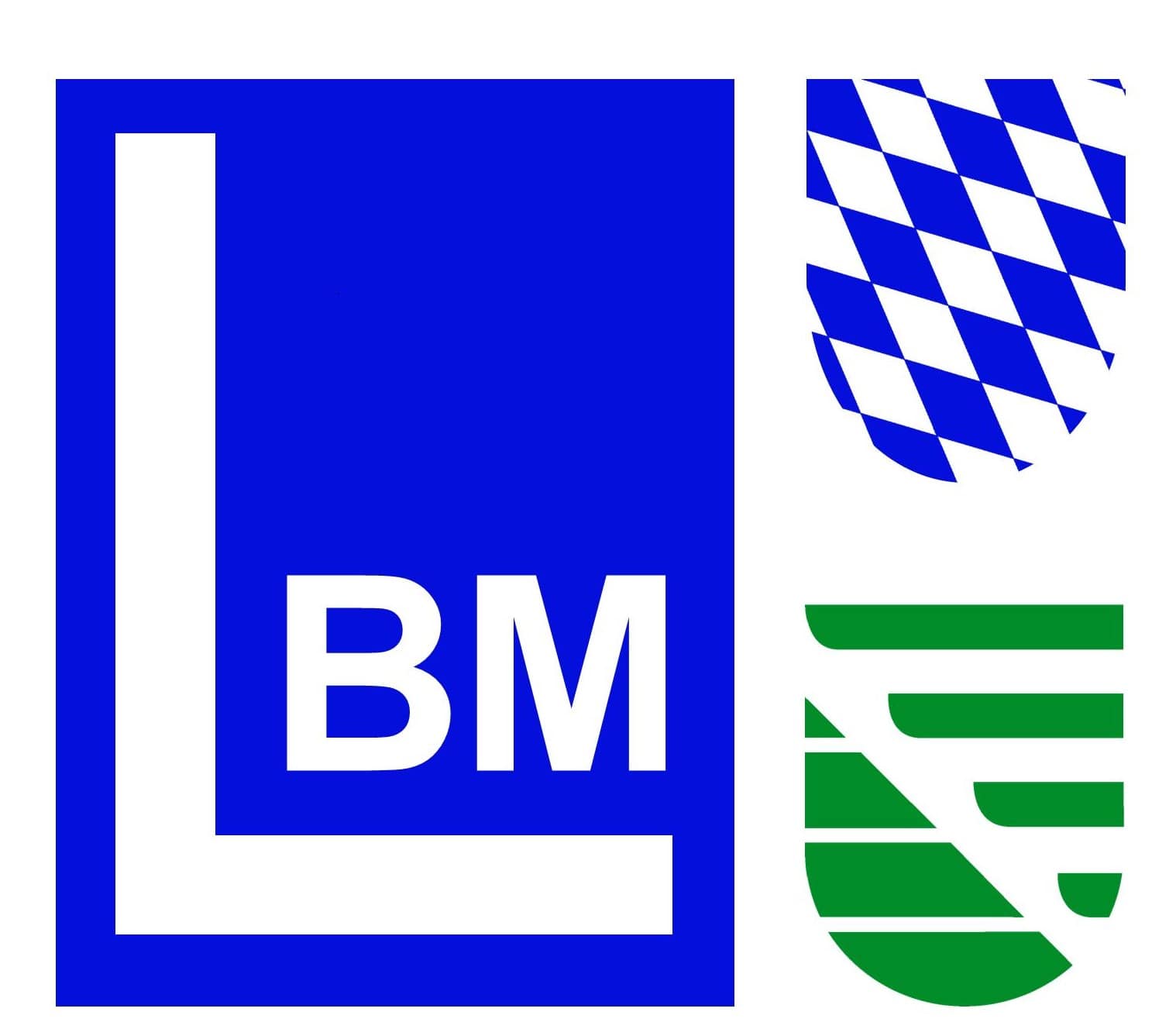Milchkühlung und Reinigung
Ein AMS stellt auch besondere Ansprüche an das Kühlsystem, die Reinigung und die Desinfektion der gesamten Anlage. Bei einer zu geringen Milchmenge können je nach Kühlsystem gerade in den Sommermonaten Probleme mit der Keimbelastung entstehen.
Bei Gemelken von nur 40 bis 80 kg/h und Melkbox kann die Milch über mehrere Stunden im Tank ungerührt stehen. Dadurch treten Kühlprobleme auf wie z. B. das Anfrieren der Milch. Aus diesem Grund müssen in vielen Fällen mit der Umstellung auf AMS auch Kühltechnik und Milchtank umgerüstet bzw. ausgetauscht werden. Hier gilt es betriebsindividuelle Lösungen gemeinsam mit den installierenden Firmen zu finden.
Welche Faktoren können zu erhöhten Keimzahlwerten führen?
Fehler im Kühlsystem
Erhöhte Keimzahlen in automatischen Melksystemen resultieren häufig aus Fehlern im Kühl- und Spülsystem des Milchlagertanks und der Milchleitungen. Während die Reinigung am Melkroboter vom Computersystem überwacht wird und mögliche Mängel, wie eine zu niedrige Spültemperatur oder eine zu geringe Reinigungskonzentration, über das Alarmsystem an den Landwirt weitergeleitet werden können, sind Mängel der Reinigung und Kühlung des Milchlagertanks, insbesondere bei älteren Modellen, schwieriger aufzudecken. Aufgrund der Tatsache, dass bei automatischen Melksystemen rund um die Uhr kleine Mengen gekühlt werden müssen, sind vorhandene alte Kühlsysteme für eine Zeitphase nach dem Spülen des Milchtanks auf eine sogenannte Intervallkühlung umzustellen, d.h. für einige Stunden erfolgt die Kühlung wiederholt nur in kurzen Intervallen, um ein Anfrieren der ersten Gemelke zu vermeiden. Die Umstellung auf den kontinuierlichen Kühlprozess lässt sich zeitsteuern.
Lange Pausen zwischen den Melkungen
Höhere Keimzahlen können weiterhin bei Anlagen auftreten, die größere Pausen zwischen den Melkungen aufweisen, z. B. bei Weidegang oder in Anlagen, die aufgrund geringer Kuhzahlen die Melkkapazität eines AMS nicht voll auslasten. Die Milch, die sich dann in der Druckleitung vom AMS zum Milchtank befindet, steht längere Zeit ungekühlt. Eine Rohrkühlung vom Roboter zum Milchkühltank kann hier Abhilfe schaffen.
Mängel bei der Reinigung des AMS
Zu den täglichen Kontrollarbeiten bei der Anlage gehört auch die Überwachung der Reinigungs-, Desinfektions- und Dippmittel. Je nach Fabrikat sind die Behälter innerhalb oder außerhalb der Maschine untergebracht. Farblich unterschiedliche Schläuche für das jeweilige Mittel sollen ein Verwechseln verhindern. Die Dosierung der Mittel erfolgt über Schlauchpumpen, die diese zeitgesteuert vornehmen. In der Regel reinigen die Anlagen im Verhältnis 2:1, d. h. zweimal alkalisch und einmal sauer. Die Kalibrierung der Mittel sollte ebenso wie der Austausch der Schläuche im Rahmen des Service durchgeführt werden. Wird das nicht gemacht, kann der Verbrauch z. B. durch eine selbst angebrachte Markierung am Kanister kontrolliert werden. Hier teilt man dann den Mittelverbrauch durch z. B. die Anzahl der Hauptreinigungen innerhalb eines 7-tägigen Zeitraums und ermittelt so den tatsächlichen Verbrauch. Eine weitere Möglichkeit zur Verbrauchsermittlung ist das Umfüllen der Reinigungs- oder Desinfektionsmittel in ein Litermaß, in das das Ansaugrohr der Schlauchpumpe gestellt wird. Zuerst wird so weit vorgepumpt, bis das Mittel an der Schlauchpumpe ansteht und dann die Schlauchpumpe entsprechend der in der Managementsoftware hinterlegten Laufzeit betätigt.
Auf welche Punkte ist bei der Desinfektion zu achten?
Desinfektionsmittel wie Peressigsäure sind klarerweise nur dort wirksam, wo sie hingelangen. Daher ist neben einer regelmäßigen Überprüfung der Konzentration auch die richtige Positionierung der Sprühdüsen notwendig. Dies kann im Rahmen des Service oder durch den Betreiber selbst vorgenommen werden. Die Konzentration der Desinfektionslösung sollte sowohl bei der Melkzeug- als auch der Bürstenreinigung bei 500 – 700 ppm liegen. Höhere Konzentrationen, wie in konventionellen Melkständen üblich, werden von einigen Praktikern in Bezug auf die Besuchsfrequenz als negativ beschrieben. Die Kontrolle des Füllstands dieser Mittel sollte ebenso wie eine Überprüfung der Konzentrationen mittels der entsprechenden Teststreifen in die wöchentliche Routine mit eingebunden werden.
Wie kann die Keimbelastung überprüft werden?
Um bei erhöhter Keimzahl die Keimquellen in einem AMS eingrenzen zu können, empfiehlt sich die Entnahme von sogenannten Tupferproben. An verschiedenen Stellen des Melksystems bis hin zum Milchkühltank werden Milchproben zur Keimzahlbestimmung entnommen. Ihr LKV unterstützt Sie hierbei gerne.
Was ist beim Sprühdippen zu beachten?
Das Zitzendippen kann einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung der Eutergesundheit leisten. Allerdings können bei Verbrauchsmengen, je nach Hersteller und Sprühverfahren, von ca. 4 bis 12 ml/Euter und Melkung und bei ca. 170 Melkungen/Tag im Jahr knapp 300 bis 750 l an Dippmittel anfallen. Der Dippmittelverbrauch beim konventionellen Melken liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnittsverbrauch bei einem AMS. Allerdings ist beim konventionellen Melken der Wirkungsgrad in der Benetzung der Zitze mitüber 90 % deutlich höher als beim automatischen Sprühverfahren (50 bis 70 %)… Es lohnt sich also die Kontrolle der Einstellung und der Sprüheffektivität, ebenso wie ein Preisvergleich. Immerhin liegt zwischen dem niedrigsten und höchsten Verbrauch, eine Differenz von knapp 800 € pro Anlage und Jahr. Dies ist abhängig von dem verwendeten Dippmittel bzw. dessen Viskosität, der Düsengröße, dem Sprühdruck und dem Abstand der Düse zur Zitzenspitze. Zusätzlich kann je nach Fabrikat auch zwischen zwei Dipp-Modi – Spar und Normal – unterschieden werden, wobei das Dippen im Normal-Modus empfohlen wird. Bevorzugt sollten die von den Melkroboterherstellern angebotenen Dippmittel, die in der Viskosität an die Druck- und Düsentechnik der Maschine angepasst sind, eingesetzt werden. Das eingesetzte Dippmittel soll ein Zitzendesinfektionsmittel sein, das ein sicheres Abtöten von S. aureus und S. agalactiae auf der Zitzenhaut garantiert. Gleichzeitig sollte das Mittel gute hautpflegende Eigenschaften besitzen. Diese Anforderungen erfüllen DLG-geprüfte Präparate. Nach dem Sprühdippen sollte an der Zitzenkuppe ein Tropfen des Dippmittel zu sehen sein. Kontrollieren lässt sich dies mittels »Löschpapiertest«. Nach dem Dippen hält man z.B. einen Karton mit einem weißen DIN-A4-Papier unter die Zitzen. Darauf sollten sich, bei passender Einstellung der Sprüheinrichtung ein »Tropfen« von jeder Zitze abzeichnen.
Mit freundlicher Genehmigung entnommen aus der Broschüre »AMS – Tipps für melkende Betriebe« des LFI Österreich