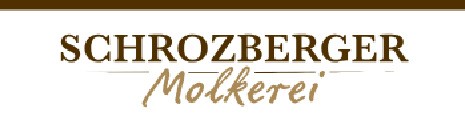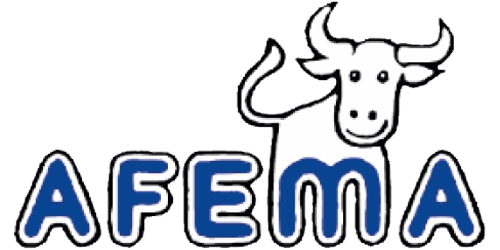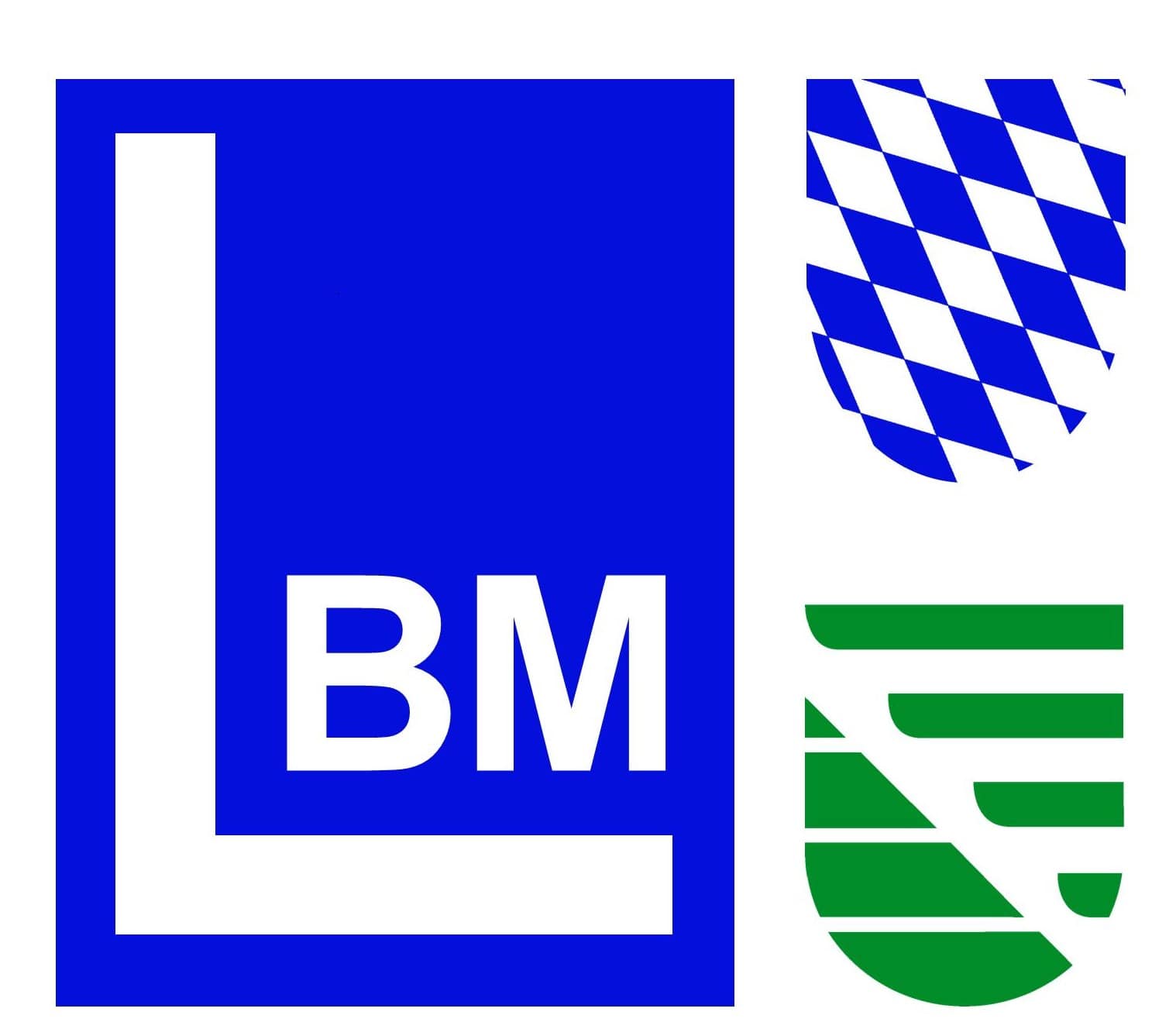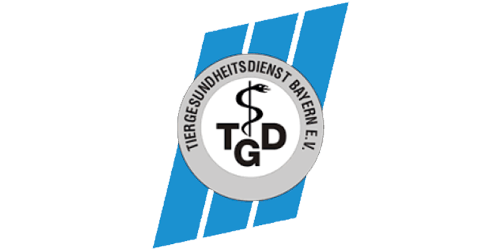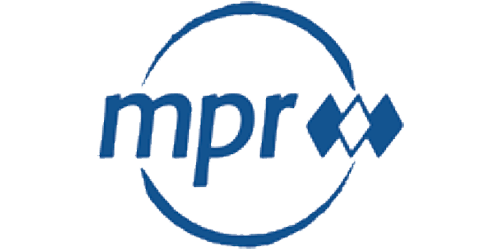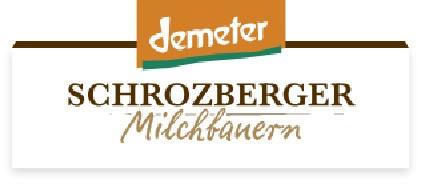Heute »out« – morgen »in«
auch wenn es sich manchmal nicht so anfühlt, die Landwirtschaft verändert sich immer. Manche Managementpraktiken kommen in Zyklen – einige Jahre sind sie »out«, nur um ein paar Jahrzehnte später wieder von der Forschung als »gut« befunden zu werden.
Die Fütterung und Aufzucht von Kälbern ist so ein Thema. Bereits Mitte des 19. Jahrhunderts wurden Landwirte auf die Wichtigkeit einer guten Kolostrumversorgung und Aufzucht von Kälbern für ihre Leistungsfähigkeit in späteren Jahren hingewiesen. Damals waren die Inhaltsstoffe von Kolostrum (bspw. Immunglobuline) zwar noch nicht bekannt, aber die, heutzutage wissenschaftlich belegten, Effekte einer guten und ausreichenden Fütterung auf die Lebensleistung waren bereits damals beobachtet worden. Vor allem nach dem Krieg wurde dann aus ökonomischen Gründen die Kälberfütterung mit Milchaustauscher empfohlen, damit die ganze Milch vermarktet werden konnte.
Aktuell beeinflussen arbeitswirtschaftliche, wirtschaftliche und Tierwohl-/Tiergesundheitsfaktoren, wie die Kälberaufzucht betrachtet wird. Während Kälber früher einzeln aufgestallt wurden, um die Einzeltierbeobachtung zu optimieren, werden mittlerweile Kälber in Kleingruppen gehalten, da sich dies als positiv für die Entwicklung der Kälber herauskristallisiert hat. Die Aufzucht von Kälbern durch Kühe – entweder direkt bei der eigenen Mutter oder bei einer Amme – wird immer mehr praktiziert, da landwirtschaftsferne Kunden fragen, warum Kälber einzeln oder von der Kuhherde getrennt gehalten werden.
Mittlerweile praktizieren etwa 3 % der bayerischen Betriebe, unabhängig von der Betriebsgröße, kuhgebundene Aufzucht. Wie der zukünftigen Milchkuh ein guter Start ins Leben gelingt und was es in der Praxis bei einer kuhgebundenen Aufzucht zu beachten gibt, wollen wir Ihnen mit der Frühjahrsausgabe der Milchpur zeigen.
Wir wünschen Ihnen zahlreiche Erkenntnisse,
Dr. Ulrike Sorge
Fachabteilungsleiterin
TGD Bayern e. V.