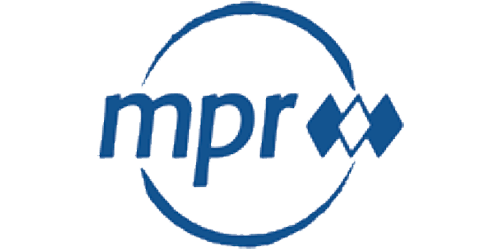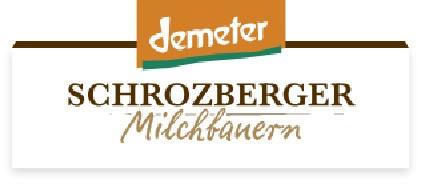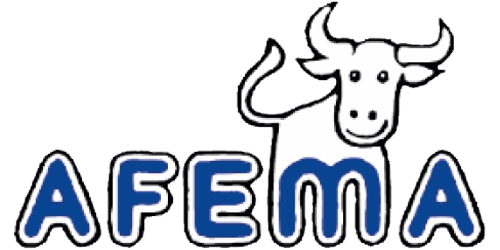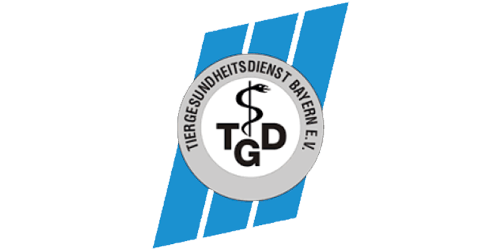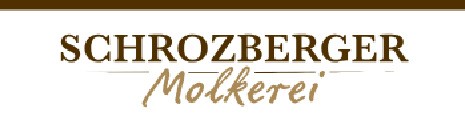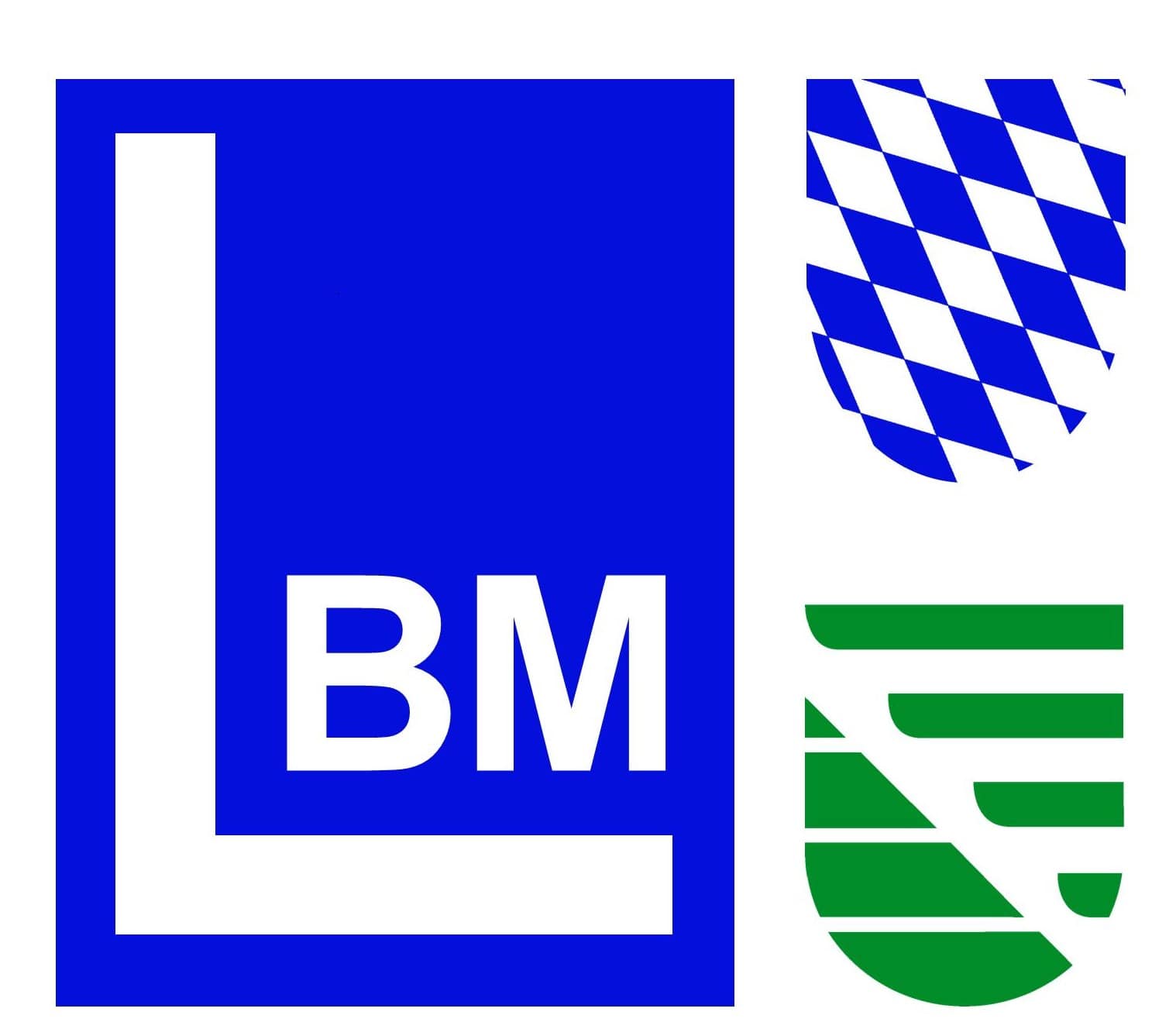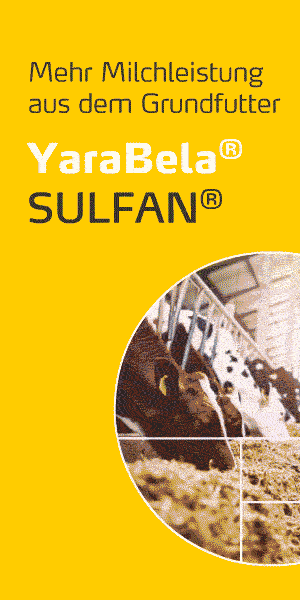LfL-Jahrestagung: Wie kann Grünland optimal genutzt und erhalten werden?
„Milch und Fleisch von Wiesen und Weiden“ – unter diesem Motto stand die diesjährige Jahrestagung der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Grub bei Poing. Rund 130 Teilnehmer diskutierten und erörterten mit Experten aus Wissenschaft, Beratung und Praxis eine optimale Nutzung von Grünland für die Betriebe bei der gleichzeitig die vielfältigen Funktionen des Ökosystems erhalten bleiben.
LfL-Vizepräsidentin Dr. Annette Freibauer umriss gleich zu Beginn die Zielrichtung der Tagung: „Grünland soll eine effektive, attraktive Futterbasis für landwirtschaftliche Betriebe sein – und gleichzeitig soll die Nutzung die wertvollen Funktionen des Ökosystems bewahren. Um diese Erwartungen bestmöglich zu erfüllen, vereinen wir die Perspektiven von Forschern, Beratern und Praktikern“.
Prof. Dr. Johannes Isselstein von der Abteilung Graslandwissenschaften der Georg-August-Universität Göttingen machte in seinem Vortrag die Perspektiven der künftigen Grünlandnutzung anhand von drei spezifischen Leistungen des Grünlands deutlich: Sein Beitrag zur Vermeidung der Nahrungskonkurrenz zwischen Nutztier und Mensch sowie zur biologischen Vielfalt in der Agrarlandschaft und dann die Rolle des Grünlands in Bezug auf die Klimawirkung. „Diese besonderen Eigenschaften des Grünlands zu stärken, ist das Ziel künftiger Landnutzung“, so Prof. Isselstein. Dazu müssten Nutzungsoptionen immer im System „landwirtschaftliche Nutzflächen und Nutztierhaltung“ entwickelt und geprüft werden. Anhand von verschiedenen Forschungsbeispielen machte Isselstein deutlich, welche konkreten Optionen derzeit bearbeitet werden. So wird beispielsweise die Rolle des Grünlands in der Fütterung der Milchkühe untersucht oder wie sich das Verhalten der Weidetiere auf die Pflanzenartenvielfalt auswirkt.
Wie man Grünland am besten in Wert setzt und was es dabei zu beachten gibt, umriss Prof. Dr. Gesa Busch, die an der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf eine Professur für Food Consumption and Wellbeing hat. In ihrem Vortrag „Aktuelle Strategien und zukünftige Perspektiven zwischen Markt, LEH und Gesellschaft“ schilderte Prof. Busch Chancen und Möglichkeiten für die Landwirtschaft, durch Weidehaltung eine höhere Akzeptanz bei der Gesellschaft zu erhalten. Grünland sei einer der letzten Orte, an denen Nutztiere für die Gesellschaft sichtbar werden. In Umfragen würden Verbraucher die Weidehaltung an erster Stelle nennen, wenn es um die Frage der Verbesserung der Haltung von Milchkühen geht. Grünland und Weidehaltung könnten daher als positiv besetzte „Visitenkarten“ der Landwirtschaft gesehen werden und einen Dialog zur Gesellschaft öffnen.
Für Stefan Thurner vom LfL-Institut für Landtechnik ist die Erfassung und Auswertung der Ertragsdaten Grundvoraussetzung für eine produktive und innovative Grünlandbewirtschaftung. „Ertragsdaten bieten die Möglichkeit, gezielt Maßnahmen zur Optimierung der Nutzungsintensität, der Bestandsführung und damit letztendlich der Ökonomik zu planen und durchzuführen“, so Thurner. Von den verschiedenen Möglichkeiten ist die sensorgestützte Ertragserfassung mit dem selbstfahrenden Feldhäcksler eine gut realisierbare, weil wenig arbeitsintensive und weitgehend automatisierte Methode. Eine Ertragsschätzung per Satellit biete zwar Vorteile bei der teilflächenspezifischen Bewirtschaftung der Grünflächen, ist aber in der Praxis nur vereinzelt verfügbar.
Barbara Misthilger vom LfL-Institut für Tierhaltung, Tierernährung und Futterwirtschaft widmete sich bei ihrem Vortrag den entscheidenden Stellschrauben, die für hohe Erträge und Qualitäten bei der Produktion von Silage verantwortlich sind. Primär gelte es, vermeidbare Verluste zu erkennen und zu minimieren. „Verlustminimierung ist kein Hexenwerk, entscheidend ist die richtige Anwendung der Technik und der vorhandenen Mittel“, so Misthilger. Die verschiedenen Möglichkeiten und Maßnahmen auf dem Feld, bei der Ernte und im Lager nahm sie anschließend unter die Lupe. Letztlich sei aber auch das Controlling unerlässlich, denn: „nur was man misst, kann man auch steuern und gezielt verbessern.“
Das Spannungsfeld zwischen Biodiversität und Effizienz war Thema des Vortrags von Sabine Obermaier vom LfL-Institut für Agrarökologie. Trotz aller Herausforderungen für die Landwirtschaft ist ihr Fazit: „Biodiversität ist keine Konkurrenz zur Effizienz – langfristig ist sie ihre Voraussetzung. Nur dort, wo die Vielfalt mitgedacht wird, bleibt die Landwirtschaft langfristig produktiv, resilient und zukunftsfähig.“, so Sabine Obermaier. Eine Herausforderung sei jedoch die praktische Umsetzung, insbesondere die Anpassung der Pflanzengesellschaften und die planerische Vorbereitung. Die meisten Betriebe müssten dazu ihr eingespieltes Bewirtschaftungssystem verändern, dies bringe kurzfristig Kosten und Arbeitsspitzen mit sich.
Die lohnende Verwertung von Grünland mit Rindern untersuchte Bernhard Ippenberger vom LfL-Institut für Agrarökonomie in seinem Referat. Generell sei mit einem weiteren Strukturwandel zu rechnen, künftig werde weniger Grünlandfläche für die Rinderhaltung benötigt. Auch wenn es nicht für alle Betriebe gelte, so sei doch eine gewisse Zweiteilung feststellbar: „Die Produktion findet entweder intensiv, also ausgerichtet auf Effizienz, oder extensiv mit Hilfe von Transferleistungen statt“, konstatierte Bernhard Ippenberger. Die höheren Kosten der extensiven Bewirtschaftung oder höherer Tierwohlstandards müssten durch Transferleistungen oder höhere Produktpreise ausgeglichen werden. Letztendlich müsse jeder Betrieb nachrechnen, ob die Zuschläge bei Milch oder Fleisch ausreichen, die zusätzlichen Kosten zu decken.
pm